Aktualisiert am 29. Mai 2025 von Angelika Klein
1. Immaterielles Kulturerbe
Es ist offiziell! Die Schwäbische Kehrwoche hat es geschafft: Sie wird als immaterielles Kulturerbe in die Liste der UNESCO aufgenommen. Damit wird erstmals eine Putztradition aus dem Herzen Europas international als erhaltenswert gewürdigt. Die Begründung: „Die Schwäbische Kehrwoche fördert soziale Kohäsion, bürgerliches Engagement und vermittelt Werte wie Ordnung, Disziplin und Rücksichtnahme.“ Und was sagt der Schwabe dazu? „So ischs recht!“
Die UNESCO zeichnet nicht nur historische Bauwerke oder Naturstätten als UNESCO-Welterbe aus – sondern auch lebendige kulturelle Traditionen, die von Generation zu Generation weitergegeben werden. Dazu zählen:
- Bräuche und Rituale
- Handwerkstechniken
- Musik, Tanz und Theaterformen
- Gesellschaftliche Praktiken und Alltagskultur
Ziel ist es, dieses kulturelle Wissen zu bewahren, das Identität stiftet und Gemeinschaft fördert. In Deutschland gehören z. B. die Brotkultur, das Kaspertheater als Spielprinzip oder das Augsburger Hohe Friedensfest zum immateriellen Kulturerbe.
Mehr dazu findest du auf der offiziellen Website der deutschen UNESCO-Kommission:
🔗 www.unesco.de/immaterielles-kulturerbe
2. Was ist die Schwäbische Kehrwoche überhaupt?
Die Schwäbische Kehrwoche ist mehr als eine lästige Pflicht – sie ist ein Lebensstil. Wer in Baden-Württemberg aufwächst, lernt schon früh: Der Gehweg kehrt sich nicht von allein. Und auch das Treppenhaus glänzt nicht ohne Grund. Die wöchentliche Putzverantwortung wird in der Regel Haus zu Haus, von Stockwerk zu Stockwerk oder von Wohnung zu Wohnung weitergegeben – meist schriftlich, gelegentlich mit mahnendem Blick der Nachbarin.
Typisch: Ein kleiner Holzbesen auf einer Holztafel, der signalisiert, wer gerade an der Reihe ist. Wehe, du vergisst es! Die Kehrwoche ist ein System aus klaren Regeln, sozialen Konventionen – und dem guten Gefühl, etwas für die Gemeinschaft zu tun (oder es wenigstens so erscheinen zu lassen). 😄
| 📍Region: | Baden-Württemberg (vor allem Stuttgart und Umgebung) – das Herzland der deutschen Sauberkeit. |
| 📜 Ursprung: | Graf Eberhard im Bart 1492: „Damit die Stadt rein erhalten wird, soll jeder seinen Mist alle Wochen ausführen.“ Ein Meister des Priorisierens, |
| 📏 Erste Vorschrift: | Gassensäuberungsordnung von 1714 – der frühe Beweis: Wo geschrubbt wird, da herrscht Struktur. |
| 🎯 Ziel: | Reinhaltung gemeinschaftlicher Flächen im Wohnumfeld – regelgerecht, systematisch und penibel. |
| 🧽 Typische Utensilien: | Schrubber, Putzeimer, Besen, Handfeger, Kehrschaufel – das Starter-Kit für Weltkultur. |
| 📛 Erkennungszeichen: | Das legendäre Holzschild mit Besensymbol oder ein minutiös geführter Kehrwochenplan – digital ist was für andere. |
| 🔄 Varianten: | Kleine Kehrwoche: Bereich vor der Wohnungstür und Treppe bis zum nächsten Stockwerk. Große Kehrwoche: Gehweg vorm Haus, Hauseingang, Kellertreppe, Gemeinschaftsräume – im Winter mit Schneeschipp-Upgrade. |
| 🤝 Soziale Wirkung: | Nachbarschaftspflege, Ordnung – und die subtile Macht des Putzplans |
Dieses vielleicht älteste bekannte Kehrwochenschild (geschätzt 19./20. Jahrhundertwende) hängt im Museum der Alltagskultur, Schloss Waldenbuch. Foto: Heike Fauter. © Landesmuseum Württemberg, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
3. Die Ursprünge: Von der Straßenreinigung zur Sozialkontrolle
Die Kehrwoche hat eine erstaunlich lange Geschichte – und sie beginnt, wie so vieles, mit Dreck. Schon 1492 verpflichtete Graf Eberhard im Bart die Stuttgarter Bürger zum Reinigen der Straßen. Das bezog sich in erster Linie auf die wöchentliche Abfuhr von Mist, Schlachtabfällen und Fäkalien. Über die Jahrhunderte wurde daraus die Institution Kehrwoche: mit festgelegten Kehrzeiten, klaren Zuständigkeiten und strengem Turnus.
Besonders beliebt: das ikonische Holzschild mit Besenmotiv, das stumm, aber eindringlich verkündet: „Du bisch jetzt dran.“ Die Kehrwoche wurde so zur schwäbischen Version sozialer Kontrolle – subtil, effizient und vollkommen geräuschlos. Das funktioniert auch nach der offiziellen Abschaffung der Kehrwoche in Stuttgart im Jahr 1988 bis heute. Denn wer seine Kehrpflicht vernachlässigt, muss zwar nicht mit dem Ordnungsamt rechnen – dafür aber mit deutlich Schlimmerem: dem getuschelten, jedoch vernichtenden Urteil der Nachbarschaft.
4. Der große Kehrwochen-Knatsch von 1988
Was viele nicht wissen: 1988 schaffte die Stadt Stuttgart unter Oberbürgermeister Manfred Rommel die Kehrwoche tatsächlich offiziell ab. Der Grund? Sie galt als nicht mehr zeitgemäß und zu bürokratisch. Der Vorstoß führte zu nichts Geringerem als einer kulturellen Erschütterung im Schwabenland. Zeitungen titelten von der „Revolution mit dem Besen“, Bürgerinitiativen forderten: „Unsere Kehrwoche bleibt!“ Und ältere Mieter:innen bestanden darauf, weiterhin den Gehweg mit dem gewohnten Ernst zu fegen – ganz egal, was das Rathaus sagt.
Letztlich wurde die Pflicht formal aufgehoben, aber praktisch? Nie verschwunden. In den meisten Mietshäusern lebt die Kehrwoche bis heute fort und wird meist im Mietvertrag geregelt. Die Schwäbische Kehrwoche – ein emotionales Erbe, das tiefer sitzt als jedes Gesetz.
5. Kehrwoche ist nicht gleich Kehrwoche
Bei der Kehrwoche gibts klare Regeln – und feine Unterschiede, die man als Außenstehende:r gern mal verwechselt. Doch Vorsicht: Wer in Schwaben mit den Begriffen Kleine und Große Kehrwoche durcheinanderkommt, riskiert nicht nur dreckige Flure, sondern auch schiefe Blicke aus dem Erdgeschoss.
Die Kleine Kehrwoche ist sozusagen die Hausflur-Variante: Du putzt den Bereich vor deiner Wohnungstür und wischst die Treppe hinunter bis zum nächsten Stockwerk. Klingt überschaubar – aber wehe, du lässt ein Wollmäuschen in der Ecke liegen. Das sieht immer jemand.
Die Große Kehrwoche ist dagegen die Königsklasse. Da gehts raus ins Gelände: Du bist zuständig für den Gehweg vor dem Haus, den Hauseingang, die Kellertreppe und die Gemeinschaftsräume. Und im Winter? Schneeschippen!
Mit Pech kommst du also von der Arbeit nach Hause – und fegst dich direkt ins Abendprogramm.
Ob groß oder klein: Die Kehrwoche kennt keine Gnade. Nur Glanz, Ordnung – und die prüfenden Blicke der Nachbarschaft.
6. Warum ist die Kehrwoche UNESCO-würdig?
- Kulturelle Tiefe: Die Kehrwoche ist Ausdruck schwäbischer Tugenden – Fleiß, Ordnung, Pünktlichkeit, Verantwortung.
- Intergenerationelle Weitergabe: Schon Kinder werden früh an Besen, Schrubber und Kehrschaufel herangeführt.
- Ritualcharakter: Immer samstags, pünktlich, schweigend – fast ein meditativer Akt.
- Soziale Funktion: Wer mitmacht, gehört dazu. Wer nicht mitmacht, ist verdächtig (mindestens!).
7. UNESCO-Würdigung für die schwäbische Ordnungskultur
In der Begründung der UNESCO heißt es:
Die Schwäbische Kehrwoche ist ein gelebtes Beispiel bürgerlicher Ordnungskultur. Ihre Weitergabe in Familie, Nachbarschaft und Mietshaus stärkt Gemeinschaft, Sauberkeit und ein friedliches Miteinander – wenn auch gelegentlich mit erhobenem Zeigefinger.
Geplant ist sogar ein internationaler Kehrwochentag, an dem symbolisch weltweit Bürgersteige gefegt werden. Erste Städte wie Tokio, Zürich und Oslo haben bereits Interesse bekundet, das Modell zu übernehmen.
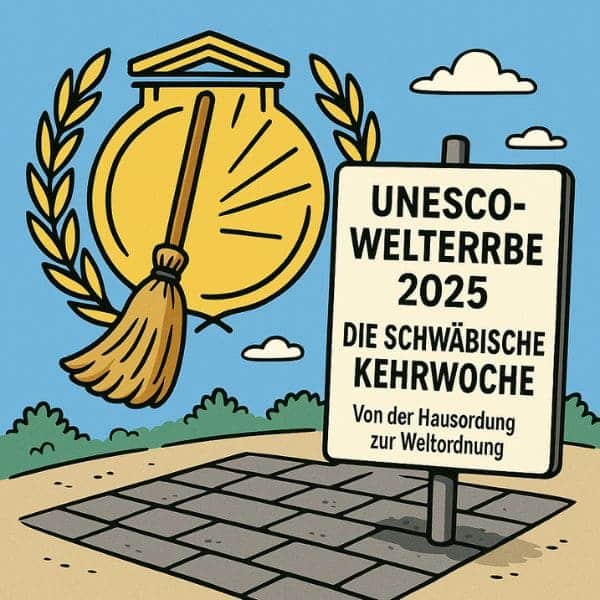
… Moment mal …
Du hältst es für eine gute Idee, die Schwäbische Kehrwoche zum Immateriellen Kulturerbe zu erklären? Ich auch, aber …
April, April!
Auch wenn wir uns das insgeheim alle wünschen: Die Schwäbische Kehrwoche hat es (noch) nicht auf die UNESCO-Liste geschafft. Aber mal ehrlich – verdient hätte sie’s doch, oder? Und – der ganze Rest in diesem Artikel stimmt!
Noch mehr deutscher Kult?
Wenn du dich für deutsche Eigenheiten, Traditionen und charmante Alltagsphänomene interessierst, findest du auf meinem Blog ab sofort regelmäßig echte Geschichten – ganz ohne Aprilscherz.








Liebe Angelika,
schade, jammerschade, dass dein Artikel nur ein 1. April Elaborat ist.
Als alter Schwabe mit schwäbischen Vorfahren bis ins Mittelalter hänge ich natürlich an der Kehrwoche. Es stimmt, was du schreibst. Die Kehrwoche ist ein Lebensstil. Und die passt doch eigentlich gut zu allen Menschen. Doch leider …
Danke für deine so inhaltsreiche Recherche und die unterhaltsame Aufbereitung.
Weiter so und saubere Grüße
Dietmar
Lieber Dietmar,
vielen Dank für deinen wertschätzenden Kommentar! Dass du als alter Schwabe dich angesprochen und unterhalten fühlst, freut mich ganz besonders. Vielleicht können wir ja in der TWS (sind ja fast alle Schwaben!) darauf hinarbeiten, dass der Aprilscherz doch noch zur Realität wird – zum Beispiel mit einem Flashmob (da wird der Name zum Programm!).
Grüßle
Angelika
Liebe Angelika,
vielen Dank für diesen Beitrag, der mich sehr zum Lachen gebracht hat! Herrlich! Ich selbst habe – zum Glück – nie in Baden-Württemberg gewohnt, denn die Kehrwoche wäre meinem Freigeist sicher zum Verhängnis geworden 😉
Sehr herzlich
Pia
Liebe Pia,
ich freu mich, dass dich mein Beitrag erheitert hat! Früher blieb mir nichts anderes übrig, als mich an die Regeln zu halten – und mehr als einmal wurde ich offen oder verdeckt der unschwäbischen Schlamperei bezichtigt. Aber in den letzten 20 Jahren bin ich nur noch in Häuser gezogen, in denen es keine Kehrwochenpflicht gab 😅. Wo ich jetzt wohne, gibt es einen Hausmeister, was ich sommers wie winters sehr genieße.
Liebe Grüße
Angelika